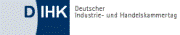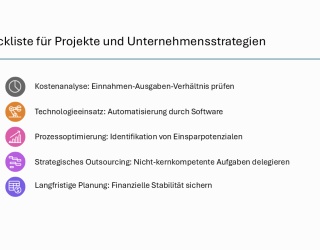Europas Finanzminister ringen derzeit um eine Einigung auf eine europaweite Finanzabgabe. Mit der Steuer sollen der Finanzsektor an den Milliardenkosten der Krise beteiligt und Spekulationen eingedämmt werden. Die Besteuerung von Finanzmärkten hat eine lange Geschichte, Krisen dauerhaft verhindert hat sie bisher aber nicht: Seit 1694 erhebt Großbritannien eine Steuer auf den Aktienhandel; bereits 1972 entwickelte der Ökonom James Tobin eine Steuer auf Devisengeschäfte; zwischen 1922 und 1991 erhob Deutschland eine Börsenumsatzsteuer; 2011 legte die EU-Kommission ihren Richtlinienentwurf für eine Finanztransaktionssteuer (FTS) vor. Bis Juni wollen die EU-Finanzminister eine Entscheidung darüber herbeiführen.
Handel mit Finanzprodukten stark gewachsen
Die Diskussion wird mit viel Vehemenz geführt – auch, weil es um vermeintlich hohe Steuereinnahmen geht. So ist der Handel mit Derivaten – die sich aus traditionellen Finanzprodukten wie Aktien, Anleihen oder Krediten ableiten – in den Jahren 2003, 2006 und 2007 um jeweils knapp 40 Prozent pro Jahr gestiegen und macht heute ein Mehrfaches des globalen Bruttoinlandsproduktes aus. Auch für die Realwirtschaft sind Derivate wichtiger geworden: Sie sichert so ihre weltweiten Geschäfte gegen Zins- oder Währungsschwankungen ab.
Europas Beispiel könnte folgenlos bleiben
Wer jetzt dem Reflex nachgibt und alle Finanzgeschäfte besteuert, macht den gleichen Fehler wie Schweden und die Schweiz gegen Ende des vorigen Jahrhunderts: Die Akteure gehen außer Landes, die Märkte werden mitnichten stabilisiert, und die Steuereinnahmen sinken. Experten bezweifeln deshalb, dass die FTS tatsächlich die von der EU-Kommission erhofften 57 Milliarden Euro einbringen wird. Die Idee, „wir Europäer“ gehen voran und alle anderen folgen, ist naiv. Kein Staat, der als Folge von Regulierungsmaßnahmen seiner Nachbarn zusätzliche Finanzinstitute bei sich ansiedeln konnte, lässt diese später wieder ziehen. Wo auch wäre sein Anreiz?
Widerstand aus Europas Hauptstädten
Trotz langer Diskussion sind die EU-Finanzminister auf ihren Sitzungen bislang nicht zu einer Lösung gekommen. Die wesentliche Frage ist nicht beantwortet: Reicht das von der Kommission vorgeschlagene Sitzlandprinzip aus, um Abwanderung zu verhindern? Danach greift die Steuer, wenn auch nur eines der beteiligten Finanzinstitute EU-ansässig ist.
Finanztransaktionssteuer birgt Risiken
Die FTS ist kein Allheilmittel. Ihre Einführung birgt Risiken und brächte einige handfeste Nachteile mit sich: Es lassen sich nicht die beiden mit der Steuer beabsichtigten Ziele – Mehreinnahmen für den Staat und stabilere Finanzmärkte – gleichermaßen erreichen. Nur, wenn die Märkte sich unbeeindruckt zeigen, fließen die Steuereinnahmen wie erwartet. Auch ist eine Unterscheidung in „nützliche“ und „schädliche“ Finanzgeschäfte in der Praxis nicht möglich. Ebenfalls problematisch: Dadurch, dass die Steuer nicht nach Risiko gestaffelt erhoben wird, werden alle Unternehmen gleich hoch belastet – auch ein Mittelständler, der nur seine Lieferungen absichert.
Die Suche geht weiter
Großbritanniens Stempelsteuer, die auf der Suche nach Kompromissen von manchen zum Vorbild erhoben wird, nimmt Anleihen, Derivate und alle von Banken gehandelten Aktien aus. Damit sind viele am Londoner Finanzplatz getätigte Finanzgeschäfte steuerfrei, und die reale Gefahr der Abwanderung und Marktaustrocknung ist wirksam gebannt. Unterm Strich richtet das Modell Großbritannien weniger Schaden als die FTS an, verhindert aber möglicherweise die nächste Krise nicht.